Es lässt sich alles Ersinnliche zu Pasteten verwenden
Jan Wagner über seinen neuen Gedichtband Achtzehn Pasteten
Ein Mailwechsel mit Gisela Trahms
Jan Wagner gibt Auskunft über seinen eben im Berlin Verlag erschienenen Gedichtband Achtzehn Pasteten. Der Autor lebt als Lyriker und Übersetzer in Berlin und wurde zuletzt mit dem Ernst-  Meister-Preis und dem Arno-Reinfrank-  Literaturpreis ausgezeichnet. |
Gisela Trahms: Sagen Sie mir doch zu Anfang etwas über den kulinarischen Titel, der heikle Assoziationen weckt. In eine Pastete kann man ja alles Mögliche reinpacken, auch Katzenfleisch, wenn kein Kalbfleisch vorhanden. Klären Sie mich auf!
Jan Wagner: Der Titel des Buches, Achtzehn Pasteten, ist gleichzeitig der des zentralen Zyklus, der achtzehn Gedichte oder eben: Gedichtpasteten umfasst. Das Ganze geht zurück auf einen Satz aus den Tagebüchern von Samuel Pepys, den ich mir vor einigen Jahren herausschrieb, weil er mir die alte Verknüpfung von Essen und Liebe auf sehr hübsche Art neu zu formulieren schien. Pepys schreibt: „Zum Mittagessen zu Sir W. Penn, der heute seinen Hochzeitstag feierte. Neben einer vorzüglichen Rinderlende und anderen Köstlichkeiten stand auch eine Platte mit 18 Pasteten auf dem Tisch, entsprechend der Zahl der Jahre, die er verheiratet ist.“ Und weil Sie ihn selbst fast wörtlich zitieren, hier noch eine Aussage von Carl Friedrich von Rumohr, die später legitimierend hinzukam und mit dem Pepys-Auszug den Zyklus einleitet: „Es lässt sich alles Ersinnliche zu Pasteten verwenden, und in der Zusammensetzung derselben kann ein braver Koch recht deutlich zeigen, dass er Einbildungskraft und Urteil besitzt.“ Die achtzehn Gedichte variieren also das Thema Liebe im weitesten Sinne und gehen dabei stets von einem Pastetengericht aus, mit dem sie motivisch mal mehr, mal weniger verknüpft sind, von der klassischen „Shepherd's Pie“ bis zu einer Süßspeise, der Quittenpastete.
G. Trahms: Ja, Pepys! Ganz unschätzbar. Ich schrieb mir einmal folgenden Eintrag heraus: „Meine Frau wieder zurück, etwas fetter geworden. Große gegenseitige Liebe.“ Wenn je ein zweiter Satz überraschend kam...! In einem Interview anlässlich Guerickes Sperling sagten Sie, dass Sie sich schon früh für Gedichte interessiert haben. Gehörte vielleicht auch die Begegnung mit einem bestimmten Dichter dazu?
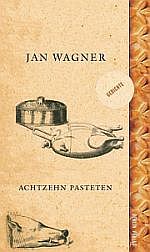
Jan Wagner
Achtzehn Pasteten
Gedichte
Berlin Verlag 2007
|
|
J. Wagner: Es gibt natürlich eine ganze Reihe von Dichtern, die ich bewundert habe und immer bewundern werde, von deren Einfluss ich auch überzeugt bin (oder deren Einfluss ich gesucht habe). Wenn Sie aber danach fragen, wer mich zum ersten Mal beglückt und erschüttert hat mit seiner Sprache, dann müsste ich Dylan Thomas nennen, mit seinen Gedichten, zuvor aber schon mit dem grandiosen Hörspiel Unter dem Milchwald.
G. Trahms: Ein Aspekt der Lyrik, der meiner Ansicht nach immer zu kurz kommt, ist ‚Entzücken‘. Entzücken beim Schreiben, Entzücken beim Lesen. In der deutschen Betrachtungslandschaft zählt die Freude ja wenig. Aber ich finde, sie wohnt gerade in der Lyrik, deswegen liebt man sie doch. Zwei Beispiele aus Der Wald im Zimmer: „deine blaue // hose, ausgebreitet wie ein delta.“ Oder: „in den abfalltonnen der donner..“ Das geht mir geradewegs in die Ohren, vor die Augen und ins Herz, eben als Entzücken über die Bilder. Das Buch vermittelt den Eindruck, dass Sie und Björn Kuhligk trotz kiloschwerer Rucksäcke auf leichte Weise leichte Bilder gepflückt haben. Auf dem Foto S.72 sieht man den Bach strömen, daneben strömt das Gedicht, selbst die ernste Schluss-Strophe schwebt noch. Dann beginnt S.137 das Pantum. Das bedeutet ja schon als Formvorgabe Mühe. Ähnlich der Kranz der Görlitz-Sonette in Guerickes Sperling. Sie erfüllen alle diese Formvorgaben brillant. Aber das spontane Entzücken will sich so recht nicht einstellen. Darauf zielen Sie nicht, muss ja auch nicht. Aber worauf? Was reizt Sie an diesen komplizierten Aufgaben? Die Virtuosität der Lösung? Die Möglichkeit, komplexere Strukturen zu bauen, als es im Einzelgedicht möglich ist? Oder meinen Sie, dass die ‚schwere‘ Form dem Text mehr Gewicht verleiht?
J. Wagner: Das Entzücken ist sicherlich Teil des Gedichts; das „Gedicht beginnt im Entzücken und endet in Weisheit“, sagt Robert Frost. Aber natürlich ist dabei mehreres zu beachten: Zum einen sind die Geschenke, die (Bild-)Findungen, die einen entzücken, nicht immer dauerhaft, nur im ersten Moment beglückend, auch für das Gedicht in seiner Gesamtheit nicht immer hilfreich – und deshalb kritisch zu beäugen; zum anderen ist das, was einen beim Lesen eines Gedichts entzücken mag (die plötzliche Verrückung, die Verblüffung, die Epiphanie meinetwegen), oft die Frucht eines weniger entzückenden als vielmehr anstrengenden Prozesses des Siebens, Verwerfens, Umschreibens, also ein Resultat weniger einer spontanen Verzückung als eines gezielten Verfahrens (weder das eine noch das andere scheint mir in Reinform aufzutreten – vielleicht ist vielmehr an eine permanente Wechselwirkung zu denken). Die Spuren der Bemühung sollten allerdings nicht zu sehen sein, auch nicht zur Schau gestellt werden. Meine Hoffnung wäre, dass auch da, wo ich komplizierte Formen benutze wie die Sestine oder das Pantum, eine Leichtigkeit spürbar ist. Auch die Halbreime tragen dazu bei, die darüberhinaus dem spielerischen Bruch der selbstgesetzten Regel, der subtilen Unterwanderung dienen. Was mich an all diesen Formen reizt, ist selbstverständlich nicht der sportliche Ehrgeiz, sie zu knacken, sicher aber der spielerische Aspekt – und vor allem die Tatsache, dass alle diese Formen, auch dank ihrer Vertracktheit, eine ganz eigene Natur, ganz individuelle Vorzüge haben, die einem Gedicht zuträglich sein können: Fraglos aber nur dann, wenn sich die Form im Verlauf selbst anbietet; vom pflichtschuldigen Auffüllen einer Form halte ich wenig. Die Verwendung ist kein Plädoyer für die Rückkehr zu alten Formen als Werten an sich, das ist klar – ich würde es aber auch als einen Verlust an Freiheit empfinden, sich nicht durch diese Formen binden zu lassen. Das schöne Paradox ist ja, dass mit diesen vermeintlich einengenden und überstrengen Formen ein Gewinn an Bewegungsmöglichkeiten einhergeht, sie also ein Korsett sein können, in dem sich besonders gut atmen lässt – nicht zuletzt auch deshalb, weil die gedanklichen und bildlichen Prozesse in ganz neue und unvermutete Bahnen gelenkt werden, was wiederum zu einer ganz eigenen Form des Entzückens führen kann. John Ashbery, der einmal gefragt wurde, warum er sich eine Form wie die Sestine überhaupt antue, sagte sinngemäß, es sei so, als ob man auf einem Fahrrad des Hang hinunterfahre, wobei nicht die Füße die Pedalen antreiben, sondern die Pedalen die Füße, und man nicht wissen könne, wo die Fahrt letztlich endet.
G. Trahms: Mir ist aufgefallen, dass Sie nur in wenigen Gedichten ‚Ich‘ sagen. Mir scheint jedenfalls, dass das lyrische Ich keine Sprachform ist, die Sie reizt.
J. Wagner: Selbst in den Gedichten, in denen ein ‚Ich‘ sich zu Wort meldet, hat dieses ‚Ich‘ mit meiner Person wenig bis gar nichts zu tun. Ich sage das deshalb, weil ja nach wie vor die Lyrik als die Gattung gilt, die dem ‚Ausdruck‘ der eigenen ‚Befindlichkeit‘ zu dienen habe, die am subjektivsten und der Stimmung des Autors geschuldet ist. Ob ein ‚Ich‘ in einem Gedicht auftaucht, ist eher eine Frage des Tons, des Stils, als eine, die sich mit den Gemütsregungen des Dichters beantworten ließe. Es stimmt wohl: Das Wörtchen ‚Ich‘ taucht relativ selten in den Gedichten auf (und ist, wenn es vorkommt, eine Maske, Teil eines Rollenspiels, wie es auch das ‚Wir‘ ist). Dies ist auch, mag sein, eine Reaktion auf die soeben erwähnte Auffassung, ein Abrücken vom ‚Ich‘ als traditionellem poetischen Reservoir – und damit, genauer, der Versuch, das Gedicht von der subjektiven Haltung zu trennen, es durch die Distanz von Autor und Text zu öffnen für die Phantasie des Lesers, des Hörers.
G. Trahms: Nur nebenbei: Es kommt mir so vor, als sei das Abrücken vom ‚Ich‘, die Distanz, die Sie beschrieben haben, ein Merkmal der Texte Ihrer Generation. Das ist interessant, weil solche Präferenzen sich ja ändern und etwas zu tun haben mit Zeitströmungen und weil der Wechsel der Formen in der Literatur fast mehr aussagt als der Wechsel der Themen. Inzwischen habe ich die Fahnen des neuen Gedichtbandes erhalten. Das erste Wort des ersten Gedichts ist ‚man‘... Noch ein paar Fragen: Sie behalten die alte Rechtschreibung bei. Grundsatz, Gewohnheit? Können Sie etwas sagen zum Aufbau, der Anordnung der Gedichte? Was hat sich verändert gegenüber Guerickes Sperling?
J. Wagner: Was die Rechtschreibung angeht, ist die Antwort kurz: Es ist nichts als Gewohnheit, das Beibehalten des Vertrauten, genau. Was den Aufbau des Bandes betrifft: Es ist ja immer eine Frage, wie sich – wenn man nicht von vorneherein eine Art Konzeptbuch im Sinn hat – eine Reihe von Einzelgedichten, die meistens ohne Blick auf zuvor geschriebene oder danach zu schreibende Texte verfasst wurden, zusammenfügen, sobald man sich hinsetzt und versucht, ein Manuskript aus ihnen zu formen. Mein Eindruck war dann, dass doch eine ganze Reihe von Texten, auch wenn das nicht beabsichtigt war, miteinander korrespondieren (abgesehen von kulinarischen Themen beispielsweise der kluge hans und der dezember 1914) und dass einige Verknüpfungen und Bögen sich von selbst ergaben – also etwa der salat als Bindeglied zwischen den Pasteten und dem Nachfolgenden, aber auch der große Rahmen, den das erste Gedicht der mann aus dem meer und das allerletzte (die Sestine über die Buchsbaumformung) bilden. Dass ich eine Entwicklung von Band zu Band sehe, versteht sich von selbst. Natürlich knüpft man dort an, wo man aufgehört hat, und das „weitermachen“ verstehe ich auch als „weiter gehen“, vorankommen. Wenn man die beiden Bücher vergleicht (was ich nicht getan habe), bin ich mir ziemlich sicher, dass neben den notwendigen Echos auch eine ganze Reihe von Brüchen und Haken zu entdecken wären.
G. Trahms: Glauben Sie, dass die Lebenssituation das Schreiben beeinflusst? Ich meine das so: Benn hatte nur eine winzige Praxis, aber sie erlaubte ihm ein vom Literaturbetrieb unabhängiges Leben. Und er war Naturwissenschaftler. Beides halte ich für zentrale Aspekte, was seine Ruppigkeit und die Entschiedenheit seiner Meinungen betrifft. Er machte Erfahrungen, die ein Philologe nicht macht, mit Leuten, denen ein Philologe in der Regel nicht begegnet. Seine Lebensorte waren bestimmt durch den Beruf, die Lebensorte heutiger Lyriker werden bestimmt durch Stipendien, Stadtschreiber, kurzzeitige Lehraufträge usw. Eine Welt außerhalb der Bücher lernen sie nicht näher kennen. Erzeugt das nicht sozusagen Bücher der Unruhe? Des Schauens und dann wieder weiter? Und eben die vielen Bücher, die aus Büchern entstehen?
J. Wagner: Ich bin mir sicher, dass die Lebenssituation das Schreiben beeinflusst. Nicht so sicher bin ich mir, ob die Schlussfolgerung zwingend ist, dass das Werk eines freien Schriftstellers, auch eines Schriftstellers, der zum Teil von Stipendien lebt, zu der berüchtigten Stipendiatenlyrik führen muss. Zwar kenne ich eine Reihe von Autoren, die genau aus diesem Grund, nämlich um dem Raum des Schreibens etwas entgegenzusetzen, sich gegen die Existenz als freier Schriftsteller entschieden haben (und etwas so genanntes ‚Richtiges‘ machen). Aber umgekehrt führt ja eine lebensgesättigte Existenz in der Welt nicht unbedingt zu welthaltigeren Texten, hilft nicht automatisch Blutarmut zu vermeiden. Und selbst für den Fall, dass jemand sich entschlösse, seine Erfahrung von ‚Leben‘ nur aus der Lektüre zu ziehen und diese wiederum umzuformen in neue Literatur – bedeutet dies doch nicht, dass eine Art inzestuöser Literatenliteratur herauskommt: Jedenfalls dann nicht, wenn man das Material zu gestalten weiß, egal, woher es kommt, ob es von erster, zweiter oder dritter Hand gespendet wurde. Denn es besteht ja die Möglichkeit, dass einer das, was Sie „die Welt außerhalb der Bücher“ nennen, ebenso präzise durch Bücher kennenlernt wie einer, der Tag für Tag im, sagen wir, Schlachthof arbeitet – oder diese Welt doch so genau und mit Feinsinn erahnt, dass ihm beim Schreiben unter der Hand eine ganze Welt gerät, die dem anderen nicht möglich gewesen wäre? Zudem ist es ja nicht so, als sähe man nichts von der Welt (oder nicht genug, um sie zu ahnen), wenn man einen Lehrauftrag annimmt, als gäbe es die Stadt nicht für den, der als Stadtschreiber tätig ist. Ist die Gefahr, mit Scheuklappen durch die Welt zu gehen, für den Stipendiaten größer als für den Schuhmacher? Wer weiß.
G. Trahms: Da habe ich Sie ja gereizt – wahrscheinlich haben Sie die Frage nach dem ‚wahren Leben‘ schon häufiger gehört, und all die Unterstellungen, die da mitschwingen, werden Ihrer Meinung nach auch nicht zutreffender, wenn man sie dauernd wiederholt. Und Sie meinen zum Schluss auch nicht „Wer weiß“, sondern „Sicher nicht“ oder „Wohl kaum“ und grollen. Jedenfalls: Weder die eine noch die andere Art zu leben ist eine Garantie für gute Gedichte, darin sind wir uns ja ganz einig, trotzdem würde ich sagen: Vom Schlachthof lesen und im Schlachthof arbeiten ist zweierlei. Ob ein gutes Gedicht zum Thema ‚Schlachthof‘ entsteht, hängt nicht davon ab, ob man dort arbeitet. Aber die Art, der Charakter des guten Gedichts vielleicht doch. Feinsinn, sagen Sie. Beware of charm!, sage ich (mit Evelyn Waugh). Vielleicht gibt es etwas, was Sie zu dem neuen Gedichtband sagen möchten und was wir hier noch gar nicht angesprochen haben?
J. Wagner: Zugegeben, dass ich die Arbeit in einem Schlachthof nicht wirklich beurteilen kann, wenn ich nur von ihr gelesen habe; ich kann aber mit dem Material unter Umständen ein welthaltigeres und gültigeres Gedicht zustandebringen als ein Dichter, der, sagen wir, am Bolzenschussgerät arbeitet. Alles, was über den Gedichtband zu sagen wäre, ist in ihm selbst zu finden.
Jan Wagner im Poetenladen 
Rezension: Jan Wagner | Achtzehn Pasteten 
Jan Wagner im Berlin Verlag 
Gisela Trahms 27.08.2007
 |
Gisela Trahms
Interview
Bericht
Prosaminiaturen
 |